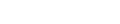Sie finden unseren Online-Adventkalender auch auf www.fb.com/steirischesvolksliedwerk
Durch den Advent mit den Volksliedwerken aus allen Bundesländern.
Klingender Adventkalender des Österreichischen Volksliedwerks:
Ab 1. bis 24. Dezember 2020 öffnet sich jeden Tag ein Fenster auf dem YouTube Channel mit Musikbeiträgen.

Mit dem Dreikönigstag geht der Weihnachtsfestkreis zu Ende – und damit wird auch unser (klingender) Adventkalender geschlossen.
Liederblatt zum Ausdrucken
Foto: Archiv Diözesanmuseum Graz

Auf der anderen Seite zählen zu den Neujahrsliedern auch reine Ansingelieder wie „Wir kommen zu euch“, die etwa von umherziehenden Neujahrssängern oder -geigern gesungen werden. Hier werden vor allem gute Wünsche für das neue Jahr ausgesprochen, wobei alle Bewohnerinnen und Bewohner des (Bauern)Hauses nacheinander angesungen werden.
Liederblatt zum Ausdrucken
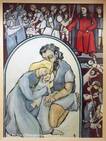
28. Dezember, von Haus zu Haus und wünschen Gesundheit und Glück für das Neue Jahr, während sie mit Zweigen oder Ruten das Gesäß der Erwachsenen bearbeiten. Der Brauch, der – gleich oder ähnlich – anderswo auch Namen trägt wie z. B. „Biesnen“, „Auffrischen“, „Aufkindeln“ etc., ist ein alter Fruchtbarkeitszauber ebenso wie ein Heischebrauch, denn trotz ihrer körperlichen Züchtigungstätigkeit erwarten die Kinder, dass sie mit Süßigkeiten oder Münzen bedacht werden.
Eigentlich steht an diesem Tag das Gedenken an den Kindermord in Betlehem auf Geheiß von König Herodes (Mt 2,16 EU) im Mittelpunkt und hierfür erfolgt nun eine symbolische Bestrafung der Erwachsenen durch Kinder. Die wohlmeinenden Verse, die die „Züchtigung“ begleiten, sind allerdings nur durch den heidnischen Ursprung des Brauchs erklärbar: Die „Rute“ galt als „Lebens- und Glücksrute“.
Lokal unterschiedliche Regelungen kann es bei der jetzt geübten Form des Brauches geben. So kann der Zeitraum des erlaubten „Schappens“ beispielsweise auf den Vormittag oder das Alter der Teilnehmer auf den Pflichtschulbesuch begrenzt sein, doch ist etwa in Feistritz an der Gail das Schappen immer noch ein Bestandteil des Burschenschaftsbrauchtums. Früher wurde das Schappen im slowenischsprachigen Raum angeblich überhaupt nur von Männern ausgeübt, wobei der Schlag mit der Rute Kindersegen bescheren und die Fruchtbarkeit fördern sollte.

Die Melodie könnte aber auch von Johann Abraham Peter Schulz (1747–1800) stammen. Dieser aus Lüneburg stammende Musiker, Musikpädagoge, Kapellmeister und Komponist verfasste über hundert „Lieder im Volkston“, darunter die Singweisen zu „Ihr Kinderlein, kommet“ auf einen Text von Christoph von Schmid (1768–1854) sowie zum Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius (1740–1815).
Liederblatt zum Ausdrucken
Foto: aufgenommen im Steirischen Heimatwerk

Wer kennt es nicht, das
Weihnachtslied schlechthin? „Stille Nacht, heilige Nacht“ wird in fast allen
Familien gesungen, es erklingt in der Kirche, in Konzerten und bei
Weihnachtsfeiern – und das weltweit und konfessionsübergreifend in mehr als 300
Sprachen. Und es ist für viele Menschen untrennbar mit dem 24. Dezember
verbunden.
Mittlerweile wurden mehrere Bücher über dieses Lied verfasst, es gibt
eine Stille-Nacht-Gesellschaft, und im März 2011 wurde es von der
Österreichischen UNESCO-Kommission in das Verzeichnis des Immateriellen
Kulturerbes aufgenommen.
Am heutigen Tag finden Sie im Adventkalender auch das
Weihnachtsevangelium nach Lukas.
Foto: Archiv Diözesanmuseum Graz

Da das Gedicht kurz ist, lässt es sich vielleicht bis morgen auswendig lernen.
Vom Christkind
Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen!
Es kam aus dem Walde, das Mützchen voll Schnee,
mit rotgefrorenem Näschen.
Die kleinen Hände taten ihm weh,
denn es trug einen Sack, der war gar schwer,
schleppte und polterte hinter ihm her.
Was drin war, möchtet ihr wissen?
Ihre Naseweise, ihr Schelmenpack -
denkt ihr, er wäre offen der Sack?
Zugebunden bis oben hin!
Doch war gewiss etwas Schönes drin:
Es roch so nach Äpfeln und Nüssen!
Foto: Krippe aus dem Steirischen Heimatwerk in Graz

„Es wird scho glei dumpa“ stammt vom oberösterreichischen Geistlichen und Mundartdichter Anton Reidinger (1839–1912), entstand im Innviertel und wurde 1884 erstmals veröffentlicht.
Als „Christkindl-Wiegenlied“ findet es sich in den von Franz Friedrich Kohl und Josef Reiter publizierten Echten Tiroler Liedern 1 von 1913. Viktor Zack (1854–1939) übernahm das bis dahin in der Steiermark „zwar nicht bekannte, aber besonders wertvolle Krippenlied“ von Kohl und machte es durch seine Sammlung Alte Krippen- und Hirtenlieder (1918) sowie durch die Aufführung bei den Hirten- und Krippenliedersingen in der Antoniuskirche in der Steiermark heimisch. Sein Kommentar dazu lautete: „Eine der herrlichsten Blüten der Volkskunst von tief ergreifender Weise und herzbezwingender Innigkeit.“
Vielerorts gab es den Brauch des „Kindelwiegens“, wobei ein schön verziertes, in einer Wiege oder Krippe liegendes Christkind – meist auch Wachs – reihum gewiegt wurde.
Liederblatt zum Ausdrucken
Foto: pixabay


Der Adventkranz kommt, wie auch der Christbaum, aus dem protestantischen
Der Adventkranz kommt, wie auch der Christbaum, aus dem protestantischen Norden Deutschlands. Dort stellte der Theologe und Sozialpädagoge Johann Heinrich Wichern (1808–1881), der Leiter des Kinderheims „Rauhes Haus“ in Hamburg, zunächst bei den Adventandachten Kerzen auf, die nach und nach entzündet wurden. Sie sollten den Kindern die Wartezeit auf Weihnachten verkürzen.
1839 verwendete er ein von der Decke hängendes Wagenrad mit einer Kerze für jeden Tag, wobei die Kerzen für die vier Sonntag größer waren. 1860 wurde dieser Leuchter erstmals mit Tannenzweige als Symbol für das Leben geschmückt, woraus sich schließlich ein Reisigkranz mit vier Kerzen entwickelte, der in Österreich etwa seit der Mitte des 20. Jahrhunderts bekannt ist.
Foto(c)pixabay_com christmas-3873418

Eines davon ist
Eines davon ist „Leise rieselt der Schnee“. Verfasst wurden der Text und vermutlich auch die Melodie 1895 vom evangelischen Pfarrer und Dichter Eduard Ebel (1839–1905) im westpreußischen Graudenz (heute Polen). Veröffentlicht ist der Text unter dem Titel „Weihnachtsgruß“ und mit „ein Kinderlied“ überschrieben in Ebels Band Gesammelte Gedichte.
Liederblatt zum Ausdrucken


Frühchristliche Krippendarstellungen zeigen nur das Jesuskind mit Ochs und Esel, um 500 kamen die Heiligen Drei Könige dazu, im
Frühchristliche Krippendarstellungen zeigen nur das Jesuskind mit Ochs und Esel, um 500 kamen die Heiligen Drei Könige dazu, im Mittelalter Maria und erst später alle die anderen Figuren. Im Barock wurden prächtige Krippen in Kirchen aufgestellt, seit dem Ende des 18. Jahrhunderts zunehmend auch in Privathaushalten. Heute gibt es eine Fülle von Darstellungen aus unterschiedlichsten Materialien in verschiedensten Stilrichtungen.
Krippenlieder schildern den Besuch der Hirten bei der Krippe. Sie bringen Geschenke, beten das Kind an und bitten es meist um seine Hilfe gegen Unwetter, Feuer, Hunger, Krankheit und Not.
Den Text „Ihr Kinderlein, kommet“ verfasste der katholische Theologe und Schuldirektor Christoph von Schmid (1768–1854) aus Augsburg, der erfolgreichste und bekannteste deutsche Kinder- und Jugendschriftsteller der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das achtstrophige Gedicht „Die Kinder bey der Krippe“ entstand um 1795 und wurde 1811 erstmals publiziert. Dazu angeregt wurde Schmid vermutlich durch die Krippe in der Stadtpfarrkirche seiner Heimatstadt Dinkelsbühl.
Lied zum Anhören (und Mitsingen)
1832 unterlegte Friedrich Heinrich Eickhoff (1807–1886), ein evangelischer Volksschullehrer aus Gütersloh, Schmids Text der Melodie des 1790 von Johann Abraham Peter Schulz (1747–1800) komponierten Frühlingsliedes „Wie reizend, wie wonnig“. Seit damals hat sich das Krippenlied weit verbreitet und wurde in viele Liederbücher aufgenommen.

In einem "normalen Jahr" würden wir unsere weihnachtlichen
In einem "normalen Jahr" würden wir unsere weihnachtlichen Veranstaltungen jetzt mit diesen bezauberten Lichtern dekorieren. Weil das heuer nicht geht, wollen wir diese Idee wenigstens mit Ihnen teilen, damit sich alle ihre eigenen Weihnachtslieder-Lichter für Zuhause basteln können.
Notenblatt-Beispiel zum Ausdrucken

In der Frühzeit bestand sein Schmuck aus „Rauschgold“ (hauchdünne Messingfolien), Früchten, Tannenzapfen und Nüssen, seit den 1830-er Jahren gibt es Christbaumschmuck aus Glas. 1878 wurde erstmals Lametta hergestellt, bald gehörten auch Strohsterne zum beliebten Christbaumschmuck.
Seit der Erfindung von Stearin (1818) und Paraffin (1837) konnten auch Christbaumkerzen industriell zu einem für größere Bevölkerungsschichten erschwinglichen Preis gefertigt werden.
Welches Lied passt besser zu diesem Thema als „O Tannenbaum“? Auch seine Nadeln sind übrigens Blätter, wie es im Lied ganz richtig heißt.
Liederblatt zum Ausdrucken
Wer lieber ein Stoffbäumchen nähen möchte, findet hier eine Video-Anleitung.

Die Volkskultur Steiermark GmbH hat eine dazu passende schöne Videoanleitung zum Strohsternbasteln veröffentlicht

Ihrer wird mit verschiedenen Bräuchen etwa in Italien, Kroatien und Ungarn am 13. Dezember gedacht, in Schweden tritt beispielsweise die Lucienbraut auf, eine weißgekleidete junge Frau mit einem Kranz brennender Kerzen auf dem Kopf.
Bis zur gregorianischen Kalenderreform war dies der Tag der Wintersonnenwende, weswegen das Hirtenlied „Hiaz is der rauhe Winter då“ heute gut passt.
Liederblatt zum Ausdrucken

Hier gibt es die Anleitung zum Selber-Basteln – der eigenen Kreativität sind dabei fast keine Grenzen gesetzt.

Als Volksbrauch ist die Herbergssuche seit dem 16. Jahrhundert belegt. „Frauenbilder“ bzw. Marienstatuen werden in der Vorweihnachtszeit von Haus zu Haus getragen, in kleinen Andachten von den jeweiligen Familien und ihren Nachbarn verehrt, über Nacht oder auch länger beherbergt und dann weitergegeben. Auch die vor allem in Westösterreich seit dem 15. Jahrhundert umherziehenden Anklöckler oder Anklöpfler spielen die biblische Herbergssuche nach.
Liederblatt zum Ausdrucken
Foto(c)Diözesanmuseum

Der Vierzeiler feiert heuer sein 40-jähriges Bestehen und zu diesem Jubiläum haben wir eine kleine Geburtstags-Ausgabe erstellt. Dazu hat Redakteur Daniel Fuchsberger einige Gstanzln gedichtet.
Das Jahresprogramm, die "Volksliedwerk-Spielwiese 2021", enthält alle unsere Sing- und Musizierkurse, -Seminare und Veranstaltungen. Hier ist bestimmt für jeden und jede etwas dabei – ob Anfänger, Fortgeschritten, Jung oder Alt.
Jahresprogramm Online
Wenn Sie noch kein Mitglied sind, können Sie unser Jahresprogramm bei uns kostenlos bestellen oder einen Blick in einige frei verfügbare Leseexemplare unseres Vierzeilers werfen (VZ 3/2007 – Jodler & Juchzer; VZ 1/2013 – Peter Rosegger; VZ 1/2019 – Hosensackinstrumente; VZ 1/2020 – Volksmusik digital) .
Am besten aber, Sie werden einfach gleich hier Mitglied und genießen zahlreiche Vorteile.
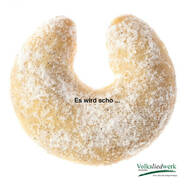
Als Titelbild der CD haben wir ein Vanillekipferl gewählt, weshalb die CD bei uns im Volksliedwerk den Rufnamen „Kipferl“ trägt.
Wenn sie die „Kipferl“-CD bis Weihnachten bei uns im Onlineshop bestellen, erhalten Sie ein „Kipferl“-Notenheft gratis dazu.
Und zusätzlich gibt es hier unser Lieblings-Vanillekipferl-Rezept zum Nachbacken.
Der tatsächliche Titel der CD „Es wird scho …“ passt übrigens gut in die aktuelle Zeit – ein bisschen Optimismus und ein Vanillekipferl dazu schaden nämlich nie!

Das Marienlied „Maria durch ein Dornwald ging“ bezieht sich auf den Besuch der schwangeren Gottesmutter bei ihrer ebenfalls schwangeren Cousine Elisabeth. Der Dornwald, der durch das Vorbeigehen von Mutter und Kind zum Blühen gebracht wird, steht für Unfruchtbarkeit und Tod.
Liederblatt zum Ausdrucken

Liederblatt zum Ausdrucken
Hirtenlieder sind meist in Mundart verfasst und beschreiben, wie die Hirten mitten in der Nacht verwundert aufwachen bzw. von den Engeln aufgeweckt werden, die frohe Botschaft hören und danach beschließen, mit Geschenken nach Bethlehem zu gehen und das neugeborene Kind zu suchen. Das wird meist sehr phantasiereich und oft auch humorvoll geschildert – hier kugeln zum Beispiel die Engeln „gånz haufnweis“ aus dem Himmel und „måchn Purzigagalan“.
Oft wird auch aufgezählt, welche Speisen die Hirten als Geschenk zur Krippe mitnehmen, in diesem Fall sind das ein Lamm, eine Henne, ein Hahn und ein „foasts Fackele“, also ein fettes Ferkel, dazu Äpfel und Birnen, Nüsse und Käse sowie Zwetschgen und Pflaumen – nicht gerade die richtige Kost für ein Neugeborenes, aber Maria und Josef werden sich bestimmt über diese Gaben freuen.

Durch ein großzügiges Goldgeschenk ermögliche er drei armen Schwestern die Heirat. Deshalb gilt er seit Jahrhunderten als mittwinterlicher Gabenbringer, weswegen er besonders bei Kindern sehr beliebt ist. Ihnen füllt er über Nacht Stiefel oder auch Teller mit Nüssen, Äpfeln und Süßigkeiten – und mittlerweile mit vielem anderen mehr. Das wird auch im Lied „Lasst uns froh und munter sein“ besungen.
Nikolaus wird als Bischof dargestellt und trägt oft neben einem Buch auch drei goldenen Kugeln, drei Brote oder drei Äpfeln. Er ist nicht nur der Patron der Kinder, sondern unter anderem auch der Seefahrer, Kaufleute, Rechtsanwälte, Apotheker, Fleischhauer, Bäcker, Getreidehändler, Schneider und Fuhrleute, er beschützt Schüler und Studenten, Pilger und Reisende, Liebende und Gebärende, steht aber auch Dieben, Gefängniswärtern und Gefangenen bei.

Für alle, die den Krampus lieber essen als sich vor ihm zu fürchten, haben wir hier eine Bastelanleitung für einen Zwetschkenkrampus. Und für jene, die auf den Krampus treffen, gibt es einen Spruch, den man ihm entgegenrufen kann:
Kramperl, Kramperl, Besnstiel,
betn kånn i eh net viel,
wås i betn kånn,
geht di gar nix ån.
Dieser Spruch sowie weitere Reime rund um Weihnachten finden sich in
Ingeborg Härtel und Monika Mogel: Weihnachtszeit in der Familie. Lieder, Sprüche, Rätselieder, hg. v. Steirischen Volksliedwerk, Gnas 2001; zu bestellen HIER
Wir können es auch mit folgendem Spruch versuchen:
Halli, hallo, wer sitzt am Klo?
Der Krampus und der Nikolo.
Sie warten schon von drei bis vier
und haben noch kein Klopapier.
Aus: Anton Hofer: Sprüche, Spiele der Lieder der Kinder (= Corpus Musicae Popularis Austriacae 16), redigiert und ergänzt von Walter Deutsch und Eva Maria Hois, Wien u. a. 2004; zu bestellen HIER
Foto(c)ginasanders

In Erinnerung daran ist es Brauch, am 4. Dezember den Zweig eines Obstbaums einzufrischen. Erblüht dieser bis Weihnachten, so bringt dies Glück und Segen – oder sogar eine Hochzeit im kommenden Jahr.
Barbara ist auch die Patronin der Bergleute, weswegen diese Anfang Dezember besondere Gottesdienst oder Barbarafeiern abhalten. Das Lied „Glück auf, liabe Bergleut“ stammt von Alfred Kerschbaum (1919–1997, Text), die Melodie von Sepp Karl (1913–2002, Melodie). Beide waren Lehrer in Ampflwang, einer Gemeinde im oberösterreichischen Hausruckviertel, die jahrzehntelang vom Braunkohlebergbau geprägt war.
Die Aufnahme des Tullnerfelder Terzetts stammt von der CD Klingender Weihnachtskalender und ist HIER erhältlich.
Liederblatt zum Ausdrucken.
Foto: Statue der Hl Barbara aus der Wehrkirche St Oswald in Eisenerz_c_wikimedia commons_haeferl_Bildausschnitt_CC BY SA 3_0_AT

Trotz
Trotz dieses Termins im Frühling ist die Verkündigung, also der Besuchs des Engels Gabriel bei Maria und seine Botschaft von der Empfängnis Jesu, eng mit dem Weihnachtsfest verbunden. So werden auch die oft als Dialoge zwischen Engel und Maria gestalteten Verkündigungslieder wie
„Der Engel des Herrn“ gerne in der Vorweihnachtszeit gesungen.
Liederblatt zum Ausdrucken
Da das Land heute unter einer Schneedecke erwacht ist, und sich nicht nur die Kleinen über die weiße Pracht freuen, wollen wir auch noch
„Schneeflöckchen, Weißröcken“ anstimmen und danach gleich einen Schneemann bauen – oder zumindest einen Schneeball werfen.
Liederblatt zum Ausdrucken

Dazu haben wir auch noch einen passenden Spruch.

„Rorate, o tauet vom Himmel herab“, das 1735 im niederösterreichischen Maria Taferl aufgezeichnet wurde. Aufgenommen wurde es bei den Hirten- und Krippenliederkonzerten in der Antoniuskirche; die CD ist hier erhältlich,
Und weil unser Adventkalender vor allem ein klingender sein soll, gibt es zu Beginn mit „Alle Jahre wieder“ auch gleich ein zweites Lied zum Mitsingen für alle.
Hier gibt es das Lied auch als Video, selber eingesungen von unserem Mitarbeiter Daniel Fuchsberger mit seinen beiden Töchtern: https://www.youtube.com/watch?v=5QEpJnqDAZ0&feature=youtu.be
Der Adventkalender aus Papier wurde übrigens 1903 vom jungen schwäbischen Pfarrerssohn Gerhard Lang (1880–1974) in München erfunden. Seine Mutter hatte ihm einst 24 Weihnachtskekse auf einen Karton aufgenäht, von welchen er jeden Tag eines essen durfte. Diese Erinnerung kombinierte er mit einem Ausschneide-Bilderbogen.


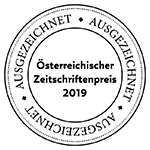
 nach oben
nach oben